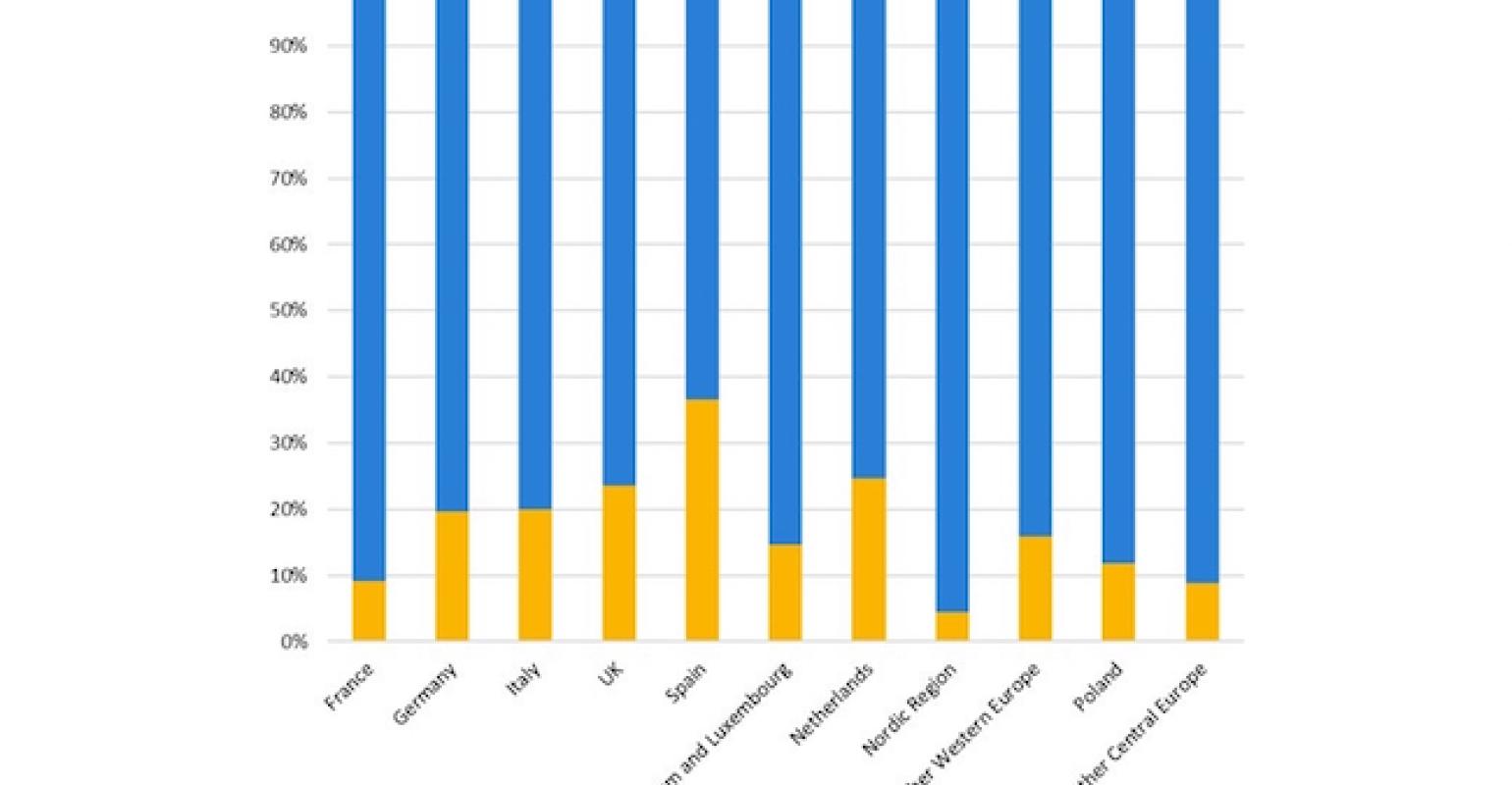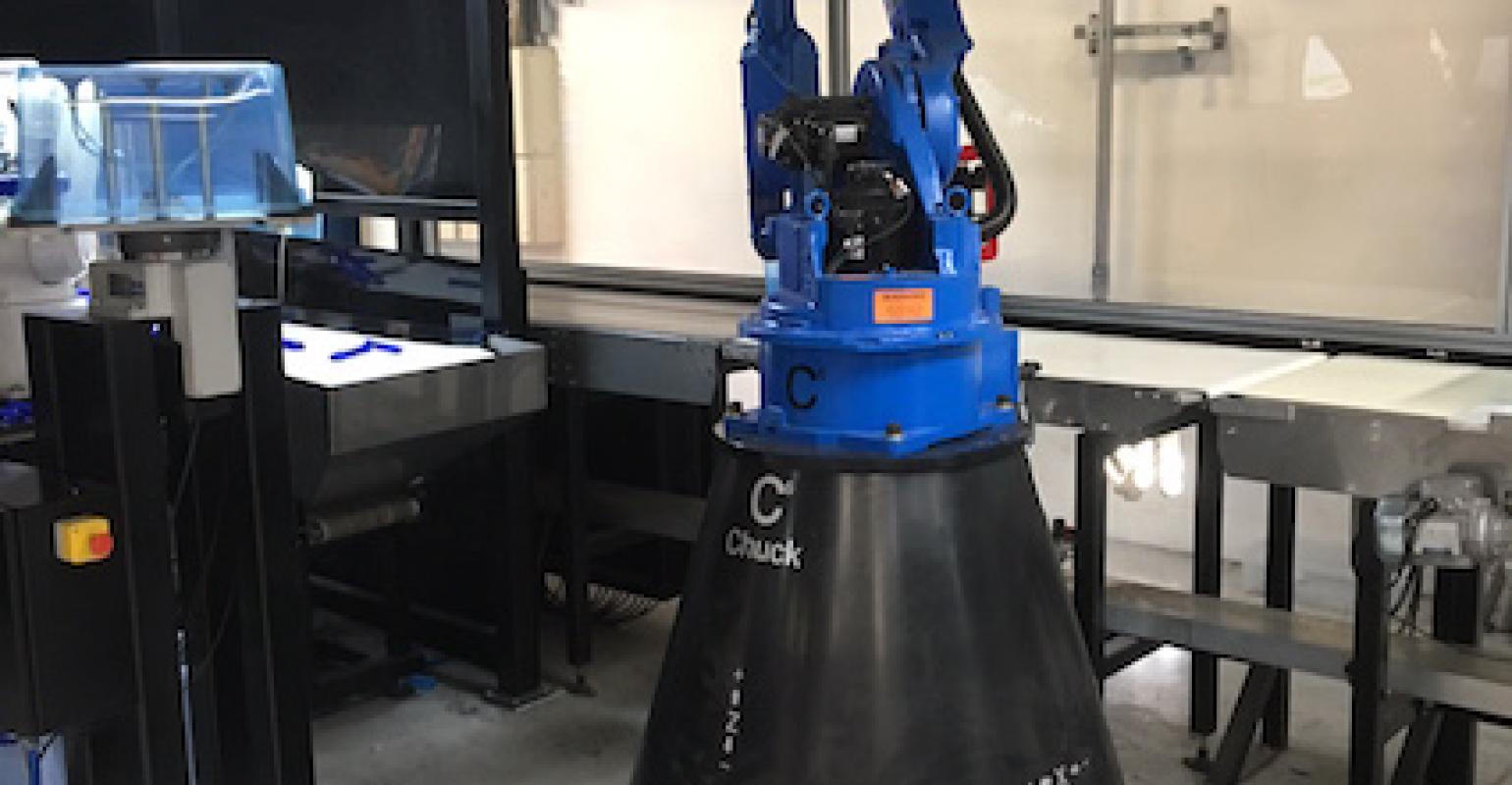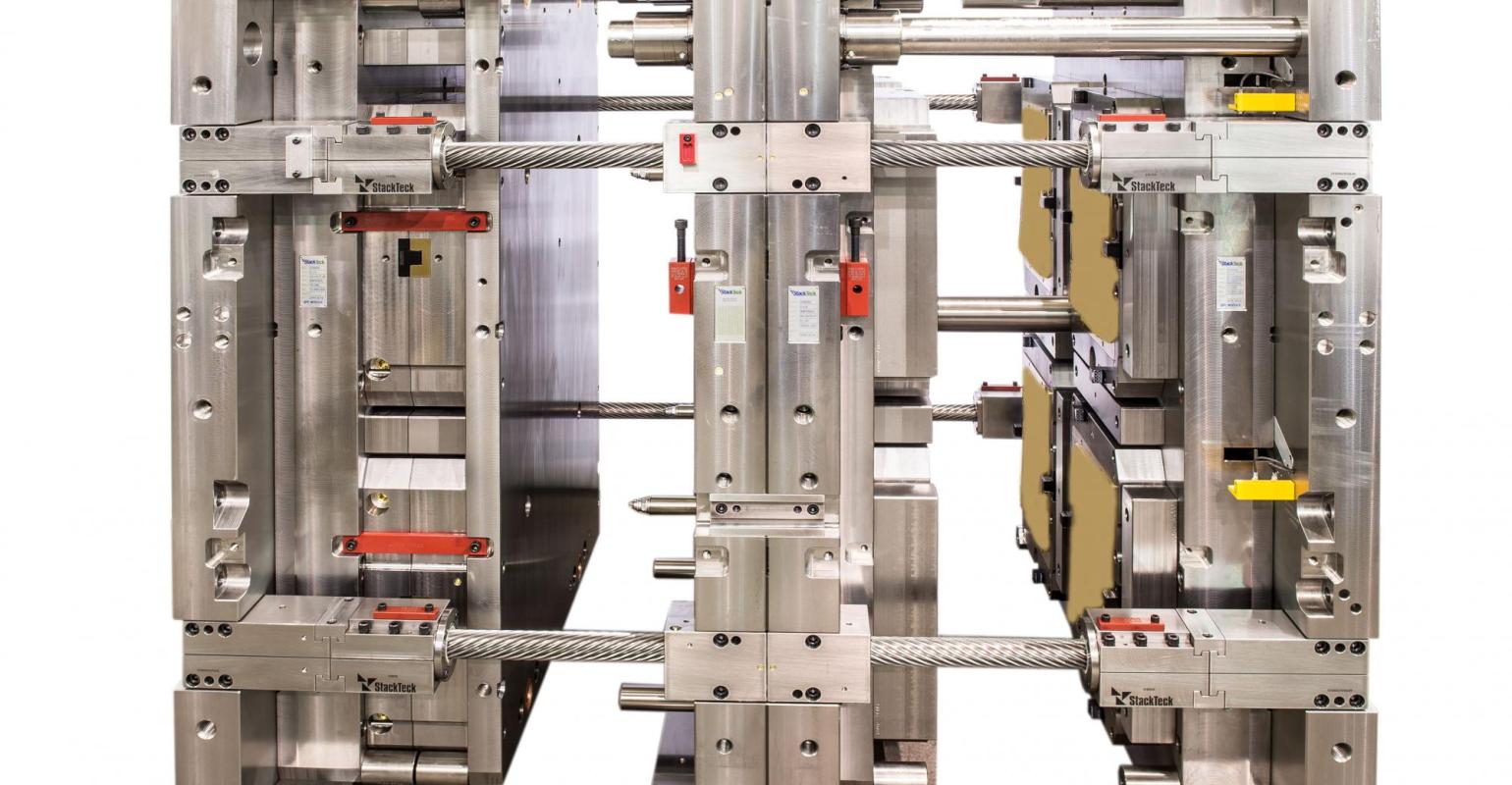Laut Forschern des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ) in Deutschland tragen Weichmacher zur Gewichtszunahme bei. Die Wissenschaftler behaupten, die dafür verantwortlichen Stoffwechselwege gefunden zu haben.
Weichmacher wie Phthalate kommen in manchen Weichkunststoffen wie PVC vor. Sie gelangen über die Haut in den Körper oder werden mit bestimmten Lebensmitteln aufgenommen. Einige Phthalate verhalten sich als endokrine Disruptoren und stehen im Verdacht, unser Körpergewicht zu beeinflussen. Die genauen Zusammenhänge und Mechanismen waren bisher unklar.
 Jetzt haben die UFZ-Forscher in Zusammenarbeit mit dem Integrierten Forschungs- und Behandlungszentrum (IFB) Adipositaserkrankungen der Universität Leipzig und des Universitätsklinikums Leipzig eine beunruhigende Studie in PLOS ONE veröffentlicht, einem von Experten begutachteten multidisziplinären Open-Access-Journal, das eine Plattform bietet Primärforschung zu veröffentlichen. Die Studie zeigt nicht nur, dass das Phthalat DEHP zu einer Gewichtszunahme führt, sondern deckt auch die daran beteiligten Stoffwechselvorgänge auf. In Europa wurde DEHP 2015 in die Liste der eingeschränkten Stoffe aufgenommen.
Jetzt haben die UFZ-Forscher in Zusammenarbeit mit dem Integrierten Forschungs- und Behandlungszentrum (IFB) Adipositaserkrankungen der Universität Leipzig und des Universitätsklinikums Leipzig eine beunruhigende Studie in PLOS ONE veröffentlicht, einem von Experten begutachteten multidisziplinären Open-Access-Journal, das eine Plattform bietet Primärforschung zu veröffentlichen. Die Studie zeigt nicht nur, dass das Phthalat DEHP zu einer Gewichtszunahme führt, sondern deckt auch die daran beteiligten Stoffwechselvorgänge auf. In Europa wurde DEHP 2015 in die Liste der eingeschränkten Stoffe aufgenommen.
In Deutschland ist jeder zweite Erwachsene übergewichtig, ebenso bis zu 15 % der deutschen Kinder und Jugendlichen. „Die Zahlen sind alarmierend“, sagt Martin von Bergen, Leiter der Abteilung Molekulare Systembiologie am UFZ. „Denn jedes Kilo über dem Idealgewicht erhöht das medizinische Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Gelenkschäden, chronische Entzündungen und Krebs und die Zahl der Übergewichtigen nimmt weltweit stetig zu.“
Während genetische Veranlagung, schlechte Ernährungsgewohnheiten und Bewegungsmangel als Faktoren angesehen werden, scheint es nun, dass bestimmte Umweltschadstoffe wie Phthalate auch mitverantwortlich für die Adipositas-Epidemie sein könnten.
„Zusammenhänge zwischen erhöhten Phthalatkonzentrationen im menschlichen Körper und der Entwicklung von Übergewicht sind bereits in epidemiologischen Studien nachgewiesen und sollten genauer analysiert werden“, sagte von Bergen.
Phthalate werden als Weichmacher in der Polymerverarbeitung eingesetzt, um Kunststoffe weich, flexibel oder dehnbar zu machen. Unter bestimmten Bedingungen können Phthalate auch aus dem Material austreten und in den Körper gelangen, im Allgemeinen aus einer Nahrungsquelle. Phthalate werden hauptsächlich aus Lebensmittelverpackungen von fetthaltigen Produkten wie Käse oder Wurst übertragen.
„Wir wissen derzeit sehr wenig darüber, wie genau Phthalate im Körper wirken und wie sie das Körpergewicht beeinflussen können – das wollten wir in unserer Studie untersuchen“, ergänzt von Bergen.
Die Studie zeigt, wo Phthalate in den Stoffwechsel eingreifen und so den Weg für eine Gewichtszunahme ebnen können. In Studien der Universität Leipzig nahmen Mäuse, die dem Phthalat DEHP im Trinkwasser ausgesetzt waren, erheblich an Gewicht zu – vor allem die Weibchen.
„Es ist offensichtlich, dass Phthalate stark in den Hormonhaushalt eingreifen. Sie bewirken bereits in geringen Konzentrationen deutliche Veränderungen, zum Beispiel Gewichtszunahme“, sagt von Bergen.
Im Mittelpunkt der Arbeiten am UFZ stand die Bestimmung der Stoffwechselprodukte im Blut der Mäuse. Die Forscher stellten fest, dass Phthalate den Anteil an ungesättigten Fettsäuren im Blut ansteigen ließen. Ein weiterer Effekt war der gestörte Glukosestoffwechsel. Auch die Zusammensetzung der Rezeptoren im Blut veränderte sich. Diese Rezeptoren sind wichtig für den allgemeinen Stoffwechsel und können diesen verändern.
„Manche Stoffwechselprodukte, die vom Fettgewebe gebildet werden, wirken auch als Botenstoffe und steuern Funktionen in anderen Organen“, erklärt von Bergen. „Allerdings ist noch nicht abschließend geklärt, wie sich die verschiedenen Wirkungen von Phthalaten auf den Stoffwechsel gegenseitig beeinflussen und letztendlich zu einer Gewichtszunahme führen.“
Den Einfluss von Phthalaten auf den Stoffwechsel wird von Bergen gemeinsam mit seinen Kollegen von der Universität Leipzig und dem Universitätsklinikum Leipzig weiter erforschen. Außerdem untersucht er mit UFZ-Kollegen der Abteilung Umweltimmunologie im Rahmen der Mutter-Kind-Studie (LiNA) den Einfluss von Phthalaten auf die Entstehung frühkindlicher Erkrankungen.
„Unser Ziel ist es, solide Grundlagenforschung zu betreiben, damit unsere Ergebnisse dann den für die Risikobewertung von Chemikalien zuständigen Behörden in Deutschland und auf europäischer Ebene bei ihren Bewertungen helfen können“, sagte von Bergen.